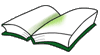Accueil
Accueil
| Titre : | Eine Bewegung bricht sich Bahn : Die deutschen Gemeinschaften im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert und ihre Stellung zu Kirche, Theologie und Pfingstbewegung. |
| Auteurs : | Dieter Lange, Auteur |
| Type de document : | texte imprimÃĐ |
| Editeur : | Giessen [Allemagne] : Brunnen Verlag, 1979 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-7655-0501-0 |
| Format : | 311 p. / Bibliographie |
| Langues: | Allemand |
| Index. dÃĐcimale : | DS/J (Eglises de maison, cellules, communautÃĐs de base) |
| RÃĐsumÃĐ : |
âGemeinschaft innerhalb der Landeskircheâ, was ist das? Dieter Lange zeigt, daà die Wurzeln dieser Bewegung im Altpietismus und in den Erweckungen des 19. Jahrhunderts liegen. Die entstehenden Gemeinschaften wollten den Mangel an geistlichem Leben innerhalb erstarrter kirchlicher Formen beheben. Dann bewertet der Autor die EinflÞsse aus dem angelsÃĪchsischen Bereich. Kurzbiographien hervorragender MÃĪnner der âHeiligungsbewegungenâ in Deutschland lassen den weiten Horizont erkennen, der jene neuen Gemeinschaften auszeichnete. Es wird gezeigt, wie sich schon bald ein festes Anliegen herausbildete: die Evangelisation kirchlich entfremdeter Menschen, die die Mietskasernen der rasch wachsenden GroÃstÃĪdte bevÃķlkerten. Die erste Gnadauer Pfingstkonferenz 1888 mit ihren Folgeveranstaltungen lÃĪÃt feste Organisationsformen finden.
Der Autor beschreibt auch, was sich von den weitgespannten PlÃĪnen und Erwartungen in der wechselvollen Geschichte realisieren lieÃ. Die Arbeit von Dieter Lange gibt einen genauen Bericht jener Ereignisse und lÃĪÃt auch den provinziellen Bereich nicht aus. Dokumentarische Einblendungen sowie ein ausfÞhrlicher Dokumentenanhang (z. B. die vollstÃĪndigen Programme der Gnadauer Pfingstkonferenz von 1888 bis 1940) ergÃĪnzen die Darstellung. So kann sich jeder Leser, sei er interessiertes Gemeindeglied, Pfarrer oder Prediger, schnell und grÞndlich Þber alle Einzelheiten, ZusammenhÃĪnge und Auswirkungen der Gemeinschaftsbewegung informieren. |
| Note de contenu : |
- Vorwort
A) EINLEITENDE VORBEMERKUNGEN - 1. Die Beurteilung der wichtigsten Darstellungen der Geschichte der deutschen Gemeinschaftsbewegung / 2. Begriffsbestimmung / 3. Ursprung und Zeitpunkt des Beginns der deutschen Gemeinschaftsbewegung B) Die Wurzeln der Gemeinschaftsbewegung - I. Die deutsch-reformatorisch-pietistische Richtung: 1. Der Pietismus lutherischer PrÃĪgung / 2. Die Erweckung des 19. Jahrhunderts / 3. Die kirchlichen und sozialen MiÃstÃĪnde in der zweiten HÃĪlfte des 19. Jahrhunderts - II. Die angelsÃĪchsisch-methodistisch-oxforder Richtung: 1. Die amerikanische Evangelisationsbewegung im 19. Jahrhundert / 2. Die Oxfordbewegung von 1874/75 (a. Der Verlauf der Oxfordbewegung; b. Robert P. Smith in Deutschland; c. Die Konferenz zu Brighton; d. Die Beurteilung der Oxfordbewegung) C) DIE ERSTEN ANFÃNGE DER DEUTSCHEN GEMEINSCHAFTSBEWEGUNG . - I. Die Auswirkungen der Oxfordbewegung in Deutschland: 1. Die Initiatoren der deutschen Heiligungsbewegung (a. Theodor Jellinghaus (1841-1919); b. Carl Heinrich Rappard (1837-1909); c. Otto Stockmayer (1838-1917) - II. GemeinschaftsgrÞndungen in Deutschland: 1. Aktive Gemeinschaftsarbeit in OstpreuÃen / 2. Gemeinschaftsvereine in Schleswig-Holstein / 3. GemeinschaftsgrÞndungen in Berlin - III. Die weitere Entwicklung der altpietistischen Gemeinschaften: 1. Im Siegerland / 2. In Baden / 3. In der Pfalz / 4. In WÞrttemberg - IV. Der Beginn der Evangelisationsbewegung in Deutschland: 1. Elias Schrenk - der Bahnbrecher deutscher Evangelisationsarbeit / 2. Professor Christlieb und die Entwicklung einer organisierten Evangelisationsbewegung D) ENTSTEHUNG UND AUSBREITUNG EINER ORGANISIERTEN GEMEINSCHAFTSBEWEGUNG - I. Die erste Gnadauer Pfingstkonferenz 1888: 1. Die Vorbereitungen zu einer Konferenz aller Gemeinschaftskreise in Deutschland / 2. Die DurchfÞhrung der ersten Gnadauer Pfingstkonferenz 1888 3. Die Beurteilung der ersten Gnadauer Pfingstkonferenz 1888 - II. Die zweite Gnadauer Pfingstkonferenz 1890: 1. Der Ablauf der Konferenz / 2. Die Bildung des âDeutschen Komitees fÞr evangelische Gemeinschaftspflegeâ - III. Die Gnadauer Konferenzen von 1892-1902: 1. Die DurchfÞhrung der Konferenz von 1892 / 2. Die vierte Gnadauer Pfingstkonferenz 1894 / 3. Die Bildung des âDeutschen Komitees fÞr evangelische Gemeinschaftspflege und Evangelisationâ / 4. Die Behandlung der Frage nach der christlichen Vollkommenheit auf der Konferenz 1896 / 5. Die sechste Gnadauer Pfingstkonferenz 1898 - IV. Die BlÞtezeit der deutschen Gemeinschaftsbewegung 1888-1902: 1. Die Entwicklung einer organisierten Gemeinschaftsarbeit (a. Die Bedeutung der Gnadauer Pfingstkonferenzen ; b. Die Bildung des âDeutschen Philadelphia-Vereinsâ ; c. Die Nakeler Gemeinschaftskonferenzen ; d. Die GrÞndung des âDeutschen Verbandes fÞr Gemeinschaftspflege und Evangelisationâ ; e. Die Leiter- und VertrauensmÃĪnnerkonferenzen in Berlin) / 2. Der innere Ausbau des Gemeinschaftswesens ( a. Die steigende Zahl der Berufsarbeiter ; b. Der Aufschwung der Jugendarbeit ; c. Das Erbauungsschrifttum der Gemeinschaften) - V. Die Stellung der KirchenbehÃķrde zur freien Evangelisationsarbeit und zur aufstrebenden Gemeinschaftsbewegung: 1. Die Eisenacher Kirchenkonferenz 1896 / 2. Die Generalsynode von 1897 / 3. Die endgÞltige Stellungnahme der KirchenbehÃķrde zur Gemeinschaftsbewegung (a. Der Beschluà der Generalsynode 1903 ; b. Die Stellung der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1904) - VI. Neue StrÃķmungen und Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinschaftsbewegung: 1. Die BemÞhungen um eine biblische Theologie (a. Der Streit um die Wiedergeburtslehre ; b. Die Auseinandersetzungen um die Verbalinspiration ? ; c. Samuel Kellers kritische Bemerkungen zur Gemeinschaftsbewegung) / 2. Der Eisenacher Bund (a. Die erste gemeinsame Konferenz von Vertretern der Kirche und Gemeinschaft 1902 ; b. Die zweite Eisenacher Konferenz 1903 ; c. Die Bildung des Eisenacher Bundes und seine weitere Bedeutung im deutschen Gemeinschaftsleben) / 3. Darbystische Tendenzen innerhalb der Gemeinschaftsbewegung (a. Die Blankenburger Allianzkonferenz ; b. Der Einfluà der damaligen Ãķstlichen Gemeinschaftskreise) / 4. Die Entwicklung einer neuen Heiligungslehre (a. J. Pauls Þberspannte Heiligungslehren ; b. Die Gnadauer Hauptkonferenz 1904) E) DIE GEMEINSCHAFTSBEWEGUNG IN DER KRISE - I. Die Erweckungsbewegung von 1905/06 und ihre Folgen fÞr die deutsche Gemeinschaftsbewegung: 1. Die Erweckung von Wales / 2. Die Erweckung in Deutschland 1905/06 (a. Der Verlauf der Erweckung ; b. Die EuropÃĪische Konferenz des Jugendbundes fÞr entschiedenes Christentum 1905 ; c. Die Blankenburger Allianzkonferenz 1905 ; d. Die Gnadauer Pfingstkonferenz 1906) / 3. Die Auswirkungen der Erweckung von 1905/06 auf die deutsche Gemeinschaftsbewegung - II. Die Pfingstbewegung: 1. Der Ursprung der Pfingstbewegung (a. Die Bibelschule in Topeka ; b. Das Zungenreden in Los Angeles ; c. Die Pfingstbewegung in Norwegen) / 2. Die Stellung der deutschen GemeinschaftsblÃĪtter zur auf kommenden auslÃĪndischen Pfingstbewegung / 3. Der Beginn der Pfingstbewegung in Deutschland (a. Deutsche Kontakte mit Christiana ; b. Die Brieger Woche 1907 ; c. Der Ausbruch der Pfingstbewegung in Kassel ; d. Die Stellung der deutschen Gemeinschaftsbewegung zu den Kasseler VorgÃĪngen ; e. Die weitere Ausbreitung der Zungenbewegung in Deutschland) / 4. Heinrich Dallmeyers RÞckzug aus der Pfingstbewegung (a. Der Widerruf Dallmeyers ; b. Die Auswirkungen der Dallmeyerschen ErklÃĪrung) / 5. Der Barmer KompromiÃbeschluà / 6. Die Gnadauer Pfingstkonferenz in den Jahren 1908 und 1909 . a) Die Konferenz von 1908...................... b) Die Konferenz von 1909 - III. Der Beginn einer organisierten Pfingstbewegung in Deutschland: 1. Die erste Pfingstkonferenz 1908 in Hamburg / 2. Die erste MÞlheimer Pfingstkonferenz 1909 - IV. Die Beurteilung der Zungenbewegung durch fÞhrende Vertreter der Gemeinschaftsbewegung: 1. Johannes Rubanowitsch: Das heutige Zungenreden / 2. Otto Schopf: Zur Casseler Bewegung / 3. Theodor Haarbeck: Die Pfingstbewegung in geschichtlicher, biblischer und psychologischer Beleuchtung / 4. Heinrich Dallmeyer: Erfahrungen in der Pfingstbewegung - V. Die Trennung von Gemeinschaftsbewegung und Zungenbewegung: 1. Die Berliner ErklÃĪrung / 2. Die Aufspaltung der deutschen Gemeinschaftsbewegung als Folge der Berliner ErklÃĪrung (a. Der geschlossene Block der Gegner ; b. Die schwankende Haltung der Neutralen ; c. Die Pfingstleute als gesonderte Gruppe auÃerhalb der Gemeinschaftsbewegung) / 3. Die Gnadauer Pfingstkonferenz 1910 / 4. Die Vermittlungsversuche der Neutralen / 5. Die wiederholten AnnÃĪherungsversuche der Pfingstler und die entschiedene Ablehnung der Gemeinschaftsbewegung F) GNADAUS MITARBEIT BEI DER NEUORDNUNG DER KIRCHLICHEN VERHÃLTNISSE - I. Die Notwendigkeit einer kirchlichen Neuordnung: 1. Unterschiedliche ÃuÃerungen fÞhrender Gemeinschaftsvertreter zur Kirchenfrage / 2. Die Stellung der ProvinzialverbÃĪnde zur bevorstehenden Neuordnung der Kirche (a. Schlesien ; b. Berlin ; c. WÞrttemberg ; d. Schleswig-Holstein ; e. Bayern ; f. ThÞringen) / 3. Die vorbereitenden GesprÃĪche zur kirchlichen Neuordnung (a. Die Elberfelder Vorbesprechung am 2. Januar 1919 ; b. Die Elberfelder Tagung am 3. Januar 1919 ; c. Die Barmer Tagung am 30. Januar 1919) / 4. Die Gnadauer Pfingstkonferenz 1920 / 5. Die Gemeinschaften und das Abendmahl / 6. Die aktive Mitarbeit der Gemeinschaftsleute bei der Neukonstituierung der Kirche (a. Der Aufruf der kirchlichen Rechten ; b. Die Auseinandersetzungen um den Bekenntnisvorspruch in der altpreuÃischen Union ; c. Die EnttÃĪuschung der Gemeinschaften Þber die neuen Kirchenverfassungen - II. Das weitere VerhÃĪltnis von Kirche und Gemeinschaftsbewegung: 1. Das Bayrische Kirchengesetz Þber auÃergewÃķhnliche Erbauungsstunden / 2. Zehn LeitsÃĪtze Þber das VerhÃĪltnis von Kirche und Gemeinschaftsbewegung / 3. Die Auseinandersetzungen zwischen Michaelis und HeitmÞller 4. Die eindeutigen Entscheidungen des Gnadauer Vorstandes. - Anhang: I. GesamtÞbersicht der Gnadauer Pfingstkonferenzen von 1888-1940 / II. Dokumente aus der Gemeinschaftsbewegung / III. Literaturverzeichnis |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | DisponibilitÃĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| DS/J 025 | DS/J 025 | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | PrÊt possible Disponible |